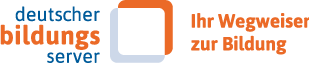Handyromane
Ein Lesephänomen made in Japan

Handyromane sind ein signifikantes und aktuelles Beispiel für die wachsende Popularität von Werken, die ihren Ursprung nicht auf Manuskriptpapier, sondern als online verfügbare Inhalte haben. Sie verdeutlichen die starke Wechselwirkung zwischen neuen technischen Entwicklungen und literarischen Formaten. Johanna Mauermann geht in ihrem Artikel der Frage nach, welche Position Handyromane in der japanischen Literatur einnehmen und ob sie als ein Indikator für ein sich wandelndes Literaturverständnis zu sehen sind.
Junge Menschen, die in der Bahn, im Café oder auf öffentlichen Plätzen mit ihrem Handy beschäftigt sind, sind ein alltägliches Bild in unserer Welt. Doch wer würde vermuten, dass hier gerade weder Nachrichten geschickt, noch Games gespielt werden, sondern womöglich der nächste Bestseller entsteht? In Japan sollte man diese Vermutung seit einigen Jahren nicht mehr abtun, denn hier haben solche sogenannten „Handyromane“ (keitai shôsetsu) Hochkonjunktur. 2007 machte die neue Form der elektronischen Literatur Schlagzeilen, als sich auf der japanischen Belletristik-Bestsellerliste unter den zehn meistverkauften Büchern des Jahres allein fünf Handyromane fanden (Tohan 2007).
Als Minimalkonsens kann dabei festgehalten werden, dass es sich bei Handyromanen um Texte handelt, die originär für die Lektüre am Handy konzipiert wurden und erst in einem zweiten Schritt in Printformat erschienen sind.
„The (…) trend has been the emergence of hit novels whose content originally appeared on websites accessed by mobile phone. These keitai shosetsu, or ‚cellphone novels’, became wildly popular when read on mobile terminals and maintained that popularity when transferred to the paper medium. The writer Yoshi’s Deep Love was the first of these to be widely read. It was received coolly by people connected to the traditional publishing industry, but vast numbers of young girls who had never read novels before (Anm.: Markierung durch J.M.) pushed it to the top of the bestseller lists, making it a significant work from the perspective of expanding the book-reading population.“ (Matsuda, Japanese Book News 51: 3)
Junge Frauen vom Teenageralter bis Mitte zwanzig haben dank der Handyromane ihr Interesse am Lesen entdeckt. Somit erschließen Handyromane dem japanischen Literaturmarkt eine völlig neue Lesergruppe. Ein Grund dafür ist, dass das Hauptmotiv von Handyromanen tragische Liebesgeschichten sind, deren Handlungsstränge dem Modell der Seifenoper Konkurrenz machen können: Aus dem Potpourri von Sex, Prostitution, Gewalt, Eifersucht, ungewollter Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, Vergewaltigung, Ritzen, Selbstmordversuche, Drogen, Krankheiten und dem Tod werden die einzelnen Erzählungen gestrickt. Dabei wirkt die Liebe romantisch verklärt als positive Kraft, die dem Leben Sinn verleiht und „Heilung“ (iyashi) bringt.
Von der Subkultur zum Mainstream
Der Autor Yoshi wird als Erfinder der Handyromane bezeichnet, seit er 2002 mit Deep Love: Ayu no Monogatari („Deep Love: Die Geschichte von Ayu“) die sogenannte „erste Boomphase“ (daiichiji kêtai shôsetsu bûmu, Honda 2008: 21) auslöste. „Deep Love“ erzählt die tragische Lebensgeschichte der 17-jährigen Schülerin Ayu, die sich – nach Missbrauch und Gewalt von zu Hause vertrieben – für ein bisschen Konsum prostituiert und keinen Sinn mehr in ihrem Leben sieht. Dies ändert sich, als sie sich in den todkranken Yoshiyuki verliebt. Beider Glück währt jedoch nicht lange und Ayu verstirbt an Weihnachten an den Folgen einer HIV-Infizierung. Die Darstellung spart dabei nicht an ausführlichen Beschreibungen von Sex und Gewalt und der Inhalt mutet reisserisch und wild zusammengeschustert an. Yoshi bot seine Geschichte sowie Nachfolgewerke auf einer selbst konzipierten Homepage zum Download an und bewarb sie mit Flyern bei Schulmädchen. Die Mädchen begeisterten sich sehr für seine Fortsetzungsserie, schickten sich die Links zum Online-Roman per Handy und forderten eine Buchversion, die schließlich 2002 erschien. Die Deep Love-Reihe hat sich über 2,7 Millionen Mal verkauft (vgl. Starts Publishing Pressemitteilung 30.08.2005). Es folgten ein Kinofilm, ein Manga und eine TV-Serie. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch wenig von einem Genre Handyroman gesprochen, da das Phänomen einzig an den Namen Yoshi geknüpft zu sein schien.
Die „zweite Boomphase“ begann 2005 und wurde stark geprägt durch kostenlose Handyportale, allen voran Mahô no I-rando („Magic Island“). Mahô no I-rando bietet Software zum Erstellen einer eigenen Homepage, sowohl für den Gebrauch am Computer wie auch am Handy. 2000 implementierte Mahô no I-rando neben Homepage-Features wie Blog oder Tagebuch mit der sogenannten „BOOK“-Option eine Applikation, mit der man Romane verfassen konnte und die sich zum großen Erfolgsrezept entwickeln sollte. Ein solches „Book“ ist ein virtuelles Buch mit einem Inhaltsverzeichnis und einzelnen Kapiteln, die man anklicken und lesen kann. Inzwischen hat die Seite nach eigener Auskunft über 5,2 Millionen registrierter Nutzer und beherbergt über 1 Million (begonnener) Romane (vgl. Kusano in Da Vinci Nr. 159: 211). Wer sich registriert, kann dort selbst Handyromane verfassen und zum Download anbieten, andere Nutzer können diese dann kommentieren oder an Freunde weiterempfehlen, so dass ein Netzwerk von Handyroman-Fans entstanden ist. Es war diese „BOOK“-Option, mit der 2005 der Handyroman zum Bestsellerphänomen wurde. Damals begannen junge, unbekannte Autorinnen unter ihrem Mahô no I-rando Spitznamen – somit unter Pseudonym – auf dem Handy Geschichten zu tippen, die „auf wahren Begebenheiten“ basieren sollten und bei denen Autorin und Hauptfigur oftmals den gleichen Namen trugen. Dieser „semi-autobiographische“ Anspruch brachte dieser Gruppe von Handyromanen die Bezeichnung riaru-kei („realistisch“, Honda 2008: 57) ein. Wie bei „Deep Love“ ist die Interaktion zwischen Autor und Leser ein charakteristisches Merkmal der Geschichten – Fans schreiben ihren Autoren und Autoren bauen auf diese Unterstützung.
Den Anfang machte Tenshi ga kureta mono („Was mir die Engel gaben“, 2005), das eine Nutzerin namens Chaco auf Mahô no I-rando darbot. Fans der Geschichte forderten vehement die Publikation des Textes ein, die schließlich 2005 erfolgte. Chaco berichtet darin von ihrer High School-Liebe, die nach vielen verpassten Gelegenheiten kurz vor dem Happy End steht, um dann doch ein tragisches Ende zu nehmen – ihr Freund stirbt bei einem Unfall. Um dieses Schicksal aufzuarbeiten, habe sie diese Geschichte niederschreiben wollen, eigentlich mehr für sich und niemals mit dem Gedanken an eine Buchveröffentlichung. Im Nachwort ihres Erstlingswerks bedankt sie sich zudem bei ihren Fans, die sie immer wieder durch Kommentare und Nachrichten zum Weiterschreiben motiviert hätten (Chaco 2005: 238f.).
Auf die Bewegung aufmerksam geworden, beobachteten die Mitarbeiter von Mahô no I-rando die Entwicklung in der online Handyromanszene und veröffentlichen nach einigen weiteren Werken den Handyroman, der aus der Subkulturbewegung endgültig ein Massenphänomen machen würde: Koizora („Liebeshimmel“, 2006) von Mika. Koizora umfasst in Printversion zwei Bände mit beachtlichen 700 Seiten – das entspricht bei 100 Zeichen pro Seite am Handydisplay unglaublichen 2800 Seiten, die von Millionen von Leserinnen komplett am Handy gelesen wurden. Mikas Roman ist mit knapp zwei Millionen verkauften Exemplaren (Stand 11/2007, vgl. Mahô no I-rando Pressemitteilung vom 19.11.2007) einer der erfolgreichsten und bekanntesten Handyromane. Die Geschichte erzählt von der Schülerin Mika und ihrer großen Liebe, die im ersten Jahr ihrer Oberschulzeit beginnt. Als Mika den Rowdy Hiro kennenlernt, verliebt sie sich in ihn und die beiden kommen zusammen und durchleben eine Zeit voller dramatischer Auf und Abs. Eines Tages trennt sich Hiro überraschend von Mika. Erst zwei Jahre später erfährt Mika den wahren Grund für Hiros Handeln: er ist an Krebs erkrankt ist und wollte ihr, seiner großen Liebe, Kummer ersparen. Die beiden kommen dennoch wieder zusammen und Mika bleibt bis zum Ende bei ihm. Mika schließt ihre Geschichte damit, dass diese Liebe alles Leid gerechtfertigt hat und sie nichts bereut.
Es ist leicht nachvollziehbar, dass die Themen der Handyromane eine vor allem weibliche Lesergruppe im Teenageralter bis Mitte zwanzig ansprechen. Sicherlich nicht das gesamte Paket, aber die einzelnen Komponenten um Sex, Eifersucht etc. werden durchaus als „real“ (riaru) empfunden, weil sie der eigenen Lebenswelt nachempfunden sind. Der Leser wird durch die starke Präsenz der Figurenrede in Form von Dialogen und (inneren) Monologen direkt angesprochen und erlebt die Gefühlslage der jeweiligen Hauptperson fast unmittelbar mit. Wird der Autor zudem als Alter Ego der Hauptperson assoziiert wie in Koizora, steigert dies das riaru-Empfinden. Das Mitfühlen (kyōkan) verstärkt sich durch das Wissen, es oftmals mit einer womöglich wahren Geschichte zu tun zu haben sowie durch die Möglichkeit, mit der Autorin in Kontakt zu treten. Tragik und Rührseligkeit der Texte führen zu einer gezielten Emotionalisierung des Lesers, die sich in Rührung (kandō) und Bewegtheit äußert.
Zwischen Kommunikationskultur und Literatur
Das Phänomen wurde in allen japanischen Printmedien diskutiert, von den Tageszeitungen über Zeitschriften aller Sparten bis hin zu allein sechs Monographien, die das Phänomen Handyroman aus verschiedenen Perspektiven soziologisch, kulturell und wirtschaftlich betrachten. Zentraler, wiederkehrender Diskussionspunkt war die Frage, ob Handyromane Literatur sind oder doch eine Form von Kommunikationskultur einer jungen Generation.
Die Handykultur der jungen Mädchen ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung für das Phänomen Handyroman. Die japanische Medienwissenschaftlerin Matsuda Misa führt an, dass das mobile Internet hauptsächlich zum Versenden von E-Mails verwendet wird und die Nutzer vor allem Frauen sind, die dabei eine eigene Form der Ausdrucksweise hervorgebracht hätten, die sich auch in den Handyromanen wiederfindet: geprägt von Umgangssprachlichkeit, Lautmalerei „Emoticons“ (Matsuda, Itô, Okabe 2006: 35). Bei den Mädchen ist ein starker Hang zum Kontakthalten per E-Mail zu erkennen, der zu zahlreichen Nachrichten pro Tag führt, die allein dem Zweck dienen, sich gegenseitig zu vergewissern, dass man aneinander denkt. Es geht nicht darum, worüber man kommuniziert, sondern darum, dass man kommuniziert. Man möchte verbunden sein (tsunagaru koto, Hayamizu 2008: 189).
Dennoch sprechen entscheidende Argumente dafür, dass Handyromane keine Form der Kommunikation, sondern eine neue Form der Literatur sind. Handyromane weisen zwar sprachlich und stilistisch Elemente einer SMS- und Internetsprache mit Lautmalerei, Smileys, Abkürzungen und Umgangssprache auf, präsentieren sich aber nicht als Kommunikationsform, wie z.B. ein Chat im Internet, sondern bereits in der Handyversion von Anfang an als virtuelles Buch mit einer klaren Einteilung in Kapitel und Seiten, einem Anfang und einem Ende. Handyromane sind weiterhin nicht nur der äußeren Form nach Bücher. Alle Werke sind „wie ‚Romane’ verfasst“ (Ishihara 2008: 18). Diese Aussage ist gerechtfertigt, da jeder der vier Romane von einem Autor verfasst wurde, der in seinem Erzählstil und in seinen Worten eine Geschichte erzählt, die in dem von ihm gesetzten Rahmen abgeschlossen ist. Kommunikation über den Text erfolgt nicht innerhalb der Geschichte, da Kommentare nicht im virtuellen Buch, sondern ausschließlich auf einer externen Seite platziert werden können. So betrachtet sind Handyromane eine Form der Literatur, via welcher Mädchen miteinander kommunizieren, wobei auch die Autorin in diese Kommunikation miteinbezogen ist. Natürlich handelt es sich somit um eine interaktivere Form der Literatur als ein herkömmlich verfasster Roman und Autorinnen wie Mika geben an, gar nicht das Gefühl gehabt zu haben, einen Roman zu schreiben, sondern eher ein Tagebuch (Mika in Ito 2007: 24). Doch ist bei Mikas Erzählung überdeutlich, dass dieses „Tagebuch“ nicht die reine Realität wiedergibt - das ist ob der unglaubwürdigen Kumulation schockierender Momente von Koizora offensichtlich, wie ein Abriss der ersten 100 von 700 Seiten verdeutlicht: Als Mika Hiro kaum kennen gelernt hat, lässt sich von ihm entjungfern und muss danach feststellen, dass er eine feste Freundin hat. Er trennt sich jedoch von dieser und Mika und Hiro kommen zusammen, sehen sich jedoch mit zahlreichen Problemen konfrontiert: Hiros eifersüchtige Ex-Freundin Saki mobbt Mika und initiiert eine Vergewaltigung, der Mika zum Opfer fällt. Daraufhin begeht Mika einen Selbstmordversuch, wird jedoch gerettet und vertraut sich ihrem Schulfreund Tatsuya an. Dieser wird seinerseits durch Hiros Eifersucht zum Schulabbruch getrieben. Zudem wird Mika von Hiro schwanger. Dies verstärkt die Gefühle der beiden füreinander und sie wollen das Kind bekommen. Doch durch eine weitere Attacke von Saki verliert Mika das Kind. Ist es im Sinne des „Tagebuchs von Mika“ demnach nicht vielmehr so, dass sich die Texte verselbständigt haben und junge Frauen wie Mika ihrer Fantasie freien Lauf ließen und damit doch zu Autorinnen wurden?
Ein neues Medium im Zeitalter des E-Kommerz
Die Analyse legt dar, dass der einfache Stil, die wenig bildhafte Darstellung und die auf Emotionalisierung abzielenden Themen der vorgestellten Handyromane im literarischen Feld keine andere Einstufung als im Bereich des Trivialen rechtfertigen. Die Zielgruppe ist dabei eng gefasst, aber zahlenmäßig groß. Somit beschreibt der Begriff Handyroman zum jetzigen Zeitpunkt eine Form der unterhaltenden Literatur für Mädchen bzw. junge Frauen, die aus neuen medialen Entwicklungen heraus entstanden ist. Handyromane stehen dabei exemplarisch für die immer stärkere Verflechtung und Wechselwirkung von Literatur, Pop- und Jugendkultur und neuen Technologien sowie den jeweils dazugehörigen Branchen.
Um dies noch einmal kurz aufzufächern: Handyromane sind nicht nur dem Namen nach Literatur. Sie sind überdies fest verankert in der japanischen Literatur, da sich in ihnen zahlreiche Strömungen der zeitgenössischen Literatur wiederfinden lassen: Auch dort wird im Rahmen des Slogans „J-Bungaku“ ein Gegenmodell zur junbungaku, der hohen Literatur, entworfen (Gebhardt 2008), wird über den Einfluss neuer Medien und Popkultur auf Literatur diskutiert, finden sich auf den Bestsellerlisten autobiographische Bücher mit dramatischen Inhalten1, ist ein Bedürfnis nach Lebenshilfe (ikikata) und Heilung (iyashi) zu verzeichnen2, gewinnt „junge Literatur“ - Werke junger Autoren - an Anerkennung3, werden ebenso die reine Liebe und zugleich die „dunklen“ Seiten der Gesellschaft thematisiert4. Der Einfluss der Pop- und Jugendkultur zeigt sich in Form der Handy-Kommunikationskultur junger Frauen. Schließlich stellen technologische Innovationen die technischen Grundlagen für das Entstehen des Genres dar: zu nennen sind hier die erwähnte „BOOK“-Option und die starke Verbreitung von Handys und des mobilen Internets, welches dank Flatrates auch für junge Menschen leicht erschwinglich ist.
Das Phänomen Handyroman ist aus ökonomischer Sicht ein zukunftsträchtiger Markt für zahlreiche Branchen, sei es für den Buchmarkt oder im Bereich E-Kommerz, für das Kino oder Fernsehen und nicht zuletzt die Musikbranche und die Merchandising-Industrie. Besonders deutlich wird hier die überragende Rolle des „Media Mix“ (media mikkusu) als Vermarktungsstrategie, d.h. die gezielte Vermarktung eines Inhalts über verschiedene Medien., sprich: Ein Bestseller-Handyroman geht regelmäßig mit einer Kino- und TV- und Manga- und Spiel-Adaption einher. So haben sich hier erstmals Handyportale (Mahô no I-rando) und Verlage (Starts Publishing, Goma Books) zusammen organisiert und aus dem rein virtuell existierenden Phänomen ein Literatur-Phänomen gemacht.
Inzwischen haben sich verschiedene Typen von Handyromanen entwickelt, solche, die von Amateuren verfasst sind und häufig autobiographische Bezüge enthalten sollen, oder aber fiktive Handyromane von Berufsschriftstellern5, und solche, die nur wie Handyromane beworben werden, aber nie ausschließlich am Handy zu lesen waren6. Zwar dominieren weiterhin die Liebesgeschichten den Markt, jedoch reicht die Genrevielfalt gleichzeitig vom historischen Roman bis zum Horror- oder Fantasy-Handyroman und auch gibt es eine erfolgreiche Minderheit von männlichen Autoren.
Das Genre und der Begriff Handyroman hat sich nach Millionen verkauften Exemplaren und weiterhin monatlichen Neuerscheinungen definitiv am Buchmarkt und in der Presse etabliert. Die Frage lautet nicht, ob Handyromane Bestand haben werden, sondern, wie zukünftige Entwicklungen aussehen werden.
Autorin: Johanna Mauermann
Über die Autorin:
Johanna Mauermann, Jahrgang 1984, studierte Japanologie und Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt. Ihre Magisterarbeit verfasste sie zum Thema „Das Phänomen Handyroman in der zeitgenössischen japanischen Literatur“. Gegenwärtig forscht sie als Doktorandin der Japanologie Frankfurt zur Kreativindustrie in Japan.
Publikation:
Johanna Mauermann: „Handyromane. Ein Lesephänomen aus Japan“
EB-Verlag, Berlin, 2011
297 Seiten, kart., 22,80 €
ISBN: 978-3-86893-041-2
Interview mit Johanna Mauermann im Deutschlandfunk am 31. Mai 2011
Anmerkungen:
1 z.B.: Dakara, anata mo ikinuite („Deshalb lebe auch du weiter“, 2000) der in ihrer Kindheit gemobbten Ôhira Mitsuyo oder Gotai fumanzoku („Unzufriedenheit mit dem ganzen Körper“, 1999) des körperlich behinderten Ototake Hirotada.
2 Siehe Fußnote 1, oder auch Allan Peases internationalen Bestseller „Why men don’t listen & women can’t read maps“, 2000.
3 2003: Verleihung des höchsten japanischen Literaturpreises, des Akutagawa-Preis, an die jüngsten Autorinnen seiner Geschichte, an die 20-jährige Kanehara Hitomi und die 19-jährige Wataya Risa.
4 Ein Beispiel für den Romantikboom um „reine Liebe“ (jun’ai) ist Sekai no chushin de ai o sakebu („Das Gewicht des Glückes“, 2007) von Katayama Kyôichi. Soziale Missstände dagegen prangert Kirino Natsuo in OUT („Die Umarmung des Todes“, 2003) an.
> 5 So veröffentlichte die geschätzte japanische Literatin Setouchi Jakuchô, ihres Zeichens 86 Jahre alt, 2008 ihren ersten Handyroman: „Tomorrow’s Rainbow“ (Ashita no niji), der sich an den großen japanischen Klassiker der Weltliteratur, das Genji Monogatari („Die Geschichte vom Prinzen Genji“), anlehnt.
6 Hier ist vor allem auf die „Handyroman-Klassiker“-Reihe des Verlags Goma Books zu verweisen, in der Klassiker der japanischen Literatur (Werke von Akutagawa Ryûnosuke, Natsume Soseki, Dazai Osamu) als Handyromane neu aufgelegt werden, sprich: in der charakteristischen Leserichtung von links nach recht, die der traditionell japanischen entgegenläuft, versehen mit Lesehilfen und in bunter Aufmachung und bunter Schrift.
Literatur:
Chaco (2005): Tenshi ga kureta mono. „Was mir die Engel gaben“. Tokyo: Starts Publishing.
Da Vinci (2007): Keitai shosetsu ’tte do na no?. „Was hat es mit Handyromanen auf sich?“. In: Da Vinci Nr. 159, Juli 2007 (Jahrgang 14, 7. Ausgabe 2007). Tokyo: Media Factory. S. 207–213.
Gebhardt, Lisette (2008): Überlegungen zur zeitgenössischen japanischen Literatur. In: Meyer, Harald (Hg.): Wege der Japanologie. Festschrift für Eduard Klopfenstein, S. 265–289.
Hayamizu, Kenro (2008): Keitai shosetsu teki. ‚futatabi yankii-ka’ jidai no shojotachi. „Handyroman-Style: Mädchen werden ‚wieder zu Yankees’“. Tokyo: Hara Shobo.
Honda, Toru (2008): Naze keitai shosetsu wa ureru ka. „Warum verkaufen sich Handyromane?“. Tokyo: Softbank Creative.
Ishihara, Chiaki (2008): Keitai shosetsu wa bungaku ka. „Sind Handyromane Literatur?“. Tokyo: Chikuma Shobo.
Ito, Onsen (2007): Keitai shosetsuka ni naru maho no hoho. „Die magische Anleitung, wie man ein Handyroman-Autor wird“. Tokyo: Goma Books.
Maho no I-rando Pressemitteilung (19.11.2007): Daihitto keitai shosetsu ‘Koizora’ shiriizu de 392-manbu. „Die Handyroman-Hitserie Koizora mit 3.92 Millionen Exemplaren.“ Tokyo: Maho no I-rando. Link: http://company.maho.jp/press/press_release/20071119koizora.pdf (Zugriff vom 30.03.2010)
Matsuda, Misa; Ito, Mizuko; Okabe, Daisuke (Hg.) (2006): Personal, portable, pedestrian. Taschenbuchausgabe. Cambridge: MIT Press.
Matsuda, Tetsuo (2007): Japanese Literature Today: Publishing Trends for 2006. In: JAPAN FOUNDATION, Japanese Book News No. 51, S. 2–3. Tokyo: Japan Foundation. Link: http://www.jpf.go.jp/JF_Contents/GetImage/img_pdf/JBN51PDF.pdf?ContentNo=9&SubsystemNo=1&FileName=img_pdf/JBN51PDF.pdf (Zugriff vom 01.04.2010)
Mauermann, Johanna (2009): Das Phänomen Handyroman in der zeitgenössischen japanischen Literatur. (Magisterarbeit am FB 9 – Sprach- und Kulturwissenschaften/Japanologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt)
Mika (2006): Koizora ~setsunai koi monogatari~ (Band 1&2). „Liebeshimmel ~ eine herzzerreißende Liebesgeschichte~“. Tokyo: Starts Publishing.
Starts Publishing Pressemitteilung (30.08.2005): Shoseki ‚koibana ao’ ‚koibana aka’ hayakumo ichii ni rankuin! „Die Buchversion von Koibana ‚blau’ und Koibana ‚rot’ steigt auf Platz 1 ein!“. Link: http://www.ozmall.co.jp/company/Release/Pdf/Release_71.pdf (Zugriff vom 30.03.2010)
TOHAN (2007): 2007 nenkan besutosera happyo. „Tohan Report zu Jahres-Bestsellern 2007“. Link: http://www.tohan.jp/cat2/year/2007_1/ (Zugriff vom 30.03.2010)
Yoshi (2002): Deep Love daiichibu. Ayu no monogatari. Deep Love. „Deep Love (Teil 1): Ayus Geschichte“. Tokyo: Starts Publishing.